Ein Kommentar von Matthias Reuter, Leitung SPZ Köln-Porz
50 Jahre Psychiatrie-Enquête
Das Sozialpsychiatrische Zentrum Köln-Porz – ein Kind der Psychiatriereform
Oder wie aus Irren Expert*innen wurden
Ohne Psychiatrie-Enquête keine Psychiatriereform und ohne Psychiatriereform würden wir
heute noch von Begriffen wie „Anstaltspsychiatrie“, von „Verrückten“ und „Irren“ sprechen. Von
Menschen, die in unwürdigen Verhältnissen leben, fernab von zu Hause, herausgerissen aus
ihrem Lebensraum. Abseits von einer Wohlstandsgesellschaft, die „Irre“ wegsperrte und sie
lieber vergaß, sie verwahrte, anstatt sie zu behandeln.
Um ein SPZ (Sozialpsychiatrische Zentrum) zu verstehen ist es wenig hilfreich, die zahlreichen
Angebote, mit großartigen Namen und nichtssagenden Kürzeln aus dem Sozialgesetzbuch
aneinanderzureihen. Um die Bedeutung und Relevanz eines SPZ zu begreifen, hilft der
berühmte Blick über den Tellerrand: genauer gesagt, die evolutionäre Entwicklung des
„Schreckgespenstes der Psychiatrie“, mit seinen verschiedenen Perspektiven auf Menschen
mit psychiatrischen Diagnosen, aus der die Sozial- bzw. Gemeindepsychiatrie und schließlich
das SPZ Köln-Porz hervorgegangen sind.
Als das SPZ Köln-Porz 1994 seine Türen öffnete, war es ein Kind der Psychiatrie-Reform. Eine
Reform, die eine bahnbrechende Veränderung einleitete und deren Bedeutung heute fast
vergessen erscheint. Blicken wir zurück: was war jetzt eigentlich die Psychiatrie-Enquête noch
einmal? Warum ist sie so besonders? Und was bedeutete es, vor der Psychiatrie-Reform,
„psychisch krank“ zu sein und wie ist Gesellschaft mit den betroffenen Menschen
umgegangen?
50 Jahre Psychiatrie-Enquête: raus aus den Anstalten
Startpunkt für die Sozialpsychiatrie und Grundsteinlegung für die SPZ, die im Rheinland
deutschlandweit einzigartig sind, war die Psychiatriereform, der die Psychiatrie-Enquête
vorausgegangen war und in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum feiert.
1971 wurde durch die damalige Bundesgesundheitsministerin Käthe Strobel die 19-köpfige
Enquête-Kommission, unter Prof. Kulenkampff (damals Landesrat vom LVR), ins Leben
gerufen. Ziel: die Beendigung des Psychiatrie-Notstands. In der Geschichte der Medizin hat
kein Ereignis das Schicksal der Kranken und die psychiatrische Versorgung so einschneidend
verbessert wie die Psychiatrie-Enquête der Bundesrepublik Deutschland. Der Bericht über die
Lage der Psychiatrie in Deutschland (Psychiatrie-Enquête) von 1975 gilt als Meilenstein in der
Geschichte der Psychiatriereform und als Ausgangspunkt tiefgreifender Veränderungen. Noch
nie zuvor und danach wurde die Psychiatrie mit ihren Entwicklungsbedarfen und -zielen so
umfassend beschrieben.
Ein dunkler Spiegel: Die lange Geschichte der Ausgrenzung
Psychisch kranke Menschen wurden über Jahrhunderte nicht als hilfsbedürftig, sondern als
„bedrohlich“, „sündhaft“ oder „wertlos“ betrachtet. Sie galten als „wahnsinnig“, „besessen“ oder
„charakterlich defekt“. Ihre Unterbringung erfolgte in Kerkern, Zuchthäusern oder später in
abgelegenen „Irrenanstalten“. Es ging nicht um Heilung – es ging um Ordnung. Um das
„Entfernen des Unpassenden“. Schon früh prägten Psychiater dieses Bild. Der Heidelberger
Direktor Friedrich Groos schrieb 1826: „Die Irrenanstalt ist im Grunde als ein Gefängnis zu
begreifen“. Christian Roller, Reformpsychiater und Gründer der Anstalt Illenau, war
überzeugt: „Der Geisteskranke muss aus seiner Umgebung gerissen und isoliert
werden. Pflege und Erziehung sind nur im Abseits möglich“.
1933–1945: Sprache wird Gewalt – Todesurteil psychiatrische Diagnose
Mit der NS-Zeit radikalisierte sich diese Haltung. Psychiatrische Diagnosen wurden zur
Grundlage für systematische Tötung. Die nationalsozialistische Sprache degradierte
Menschen zu „unnützem Leben“, „Ballastexistenzen“ oder „lebensunwertem Dasein“. Viele
führende Psychiater machten mit – aktiv, planend, schweigend. Werner Heyde, psychiatrischer
Gutachter und zentraler Organisator der NS-Tötungsprogramme, rechtfertigte die Tötung
„psychisch Kranker“ als „notwendige Maßnahme zur biologischen Hygiene des
Volkskörpers“. Carl Schneider, Psychiatrieprofessor in Heidelberg, nannte behinderte Kinder
„geistige Todeskandidaten“. Auch er war an Kindermorden beteiligt.
Zeitleiste: Aktion T4 und die industrielle Vernichtung
• 1939: Adolf Hitler unterzeichnet die geheime „Ermächtigung zur Tötung unheilbar
Kranker“.
• 1940: In sechs Tötungsanstalten (u.a. Hadamar, Grafeneck) werden über 70.000
Menschen vergast – geplant, organisiert, begleitet von Psychiatern und Verwaltung.
• 1941: Nach Protesten (u.a. von Bischof von Galen) wird die „Aktion T4“ offiziell
gestoppt – die Tötungen gehen jedoch dezentral weiter.
• 1941–1945: Weitere 30.000 bis 40.000 Menschen sterben durch Injektionen,
Hungerkost, Vernachlässigung.
• 1945: Das NS-Regime endet. Viele Täter bleiben unbehelligt.
Nach 1945: Schuld, Schweigen, Stillstand
Mehr als 100.000 psychisch kranke und behinderte Menschen wurden zwischen 1939 und
1945 ermordet. Kliniken wurden zu Tatorten und Psychiater zu Tätern. Nach dem Krieg wurde
die Beteiligung der Psychiatrie an den Morden nur zögerlich aufgearbeitet. Viele NS-belastete
Psychiater blieben in Amt und Würden – an Kliniken, Universitäten, Ministerien. Die
Verwahrpsychiatrie lebte weiter. Anstalten blieben überfüllt, mit fragwürdigen Therapieformen,
und entmenschlichend.
Während des Wirtschaftswunders in der neuen Bundesrepublik wurden die psychisch Kranken
schlichtweg in den menschunwürdigen Massenunterkünften der Psychiatrie, fernab von
Städten, vergessen. Erst in den 1960er Jahren begannen vereinzelte Stimmen, dieses System
zu hinterfragen.
Noch 1973 sprach die Enquête-Kommission des Bundestags von „brutaler Realität“ und „nicht
hinnehmbaren Verhältnissen“ in der bundesdeutschen Psychiatrie. Der Psychiater und
Zeitzeuge Heinz Häfner resümierte später: „Die Enquête war ein Akt der verspäteten
Zivilisierung. Sie war die erste echte Hinwendung zur Humanität in der Geschichte der
deutschen Psychiatrie“.
Die Enquête als Wendepunkt (1975)
Die Psychiatrie-Enquête des Bundestags stellte die Zustände offen bloß. Sie forderte eine
radikale Wende: Weg vom Verwahren, hin zu gemeindenaher, menschenwürdiger Versorgung.
Sozialpsychiatrische Zentren, insbesondere im Rheinland, wurden konkrete Bausteine dieser
Reform.
Sozialpsychiatrische Zentren: gemeindenahe Versorgung
Psychisch kranke Menschen wurden nicht mehr aus dem Alltag und Lebensraum gerissen.
Hilfen sollten dort ansetzen, wo Menschen leben: im häuslichen Umfeld, im Stadtteil, in der
Gemeinde. Ambulante Angebote wie SPZ, begleitetes Wohnen, Tagesstätten und mobile
Dienste ersetzten zunehmend die stationäre Langzeitunterbringung. Im Zentrum stehen heute
Teilhabe statt Ausgrenzung, Unterstützung und Personenzentrierung statt Zwang. Aus „Irren“,
„Kranken“ und „unwertem Leben“, sind Expert*innen in eigenen Angelegenheiten geworden.
Dazu eine offizielle Definition von der AGpR (Arbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrie
Rheinland e. V.): SPZ sind essenzielle Bausteine und Lotsen in der sozialpsychiatrischen
Versorgungslandschaft, die durch Niederschwelligkeit und Personenzentrierung
gekennzeichnet sind. Sie arbeiten sozialträgerübergreifend und sind aktiv an Netzwerken
beteiligt. Ob Krisensituation, Fragen von Betroffenen, Angehörigen oder Nutzenden, zu
psychischen Krankheitsbildern, Unterstützungsmöglichkeiten und Psychoedukation oder zur
Prävention, berät und unterstützen die SPZ. Dabei gelten die Prämissen der Ressourcen-,
Lösungs- und Stärkenorientierung, der Abbau von Barrieren, die Teilhabe im Wege stehen.
Unabhängig von Schwere oder Intensität der „psychischen Erkrankung“. Flankiert werden die
Prämissen durch die Konzepte Recovery, Empowerment, Niederschwelligkeit und
Sozialraumorientierung. Dabei spielen Status, Religionszugehörigkeit, Geschlecht, Sprache
oder kultureller Hintergrund keine Rolle.
Ein Beispiel gelebter Reform: SPZ Köln-Porz
Wie aus den Leitlinien der Psychiatriereform konkrete, lebensnahe Hilfen entstanden, zeigt
das SPZ Köln-Porz. Hier wird sichtbar, wie gemeindenahe Versorgung, Teilhabe und
persönliche Unterstützung im Alltag der Nutzenden heute gestaltet werden können.
Das SPZ Köln-Porz ist die erste Anlaufstelle für Menschen mit psychiatrischen Diagnosen,
psychischen Problemen, mentalen Krisen oder deren Angehörige. Ohne bürokratische Hürden
oder endlose Wartezeiten treffen Expert*innen in eigenen Angelegenheiten auf empathische
offene Ohren von Expert*innen für Lösungsprozesse.
Kontrastierend zur naturwissenschaftlichen Disziplin der Psychiatrie, die von kleinen
Zeitfenstern und einem defizitären „Krankheitsblick“ geprägt ist und Seelenheil qua Medizin
behandelt, geht es im SPZ um die soziale Dimension psychischer Sensationen. Deutlich wird
der Gegensatz im Bereich der Lösungen: die Psychiatrie hat bereits vorgefertigte Lösungen
für alle psychischen Probleme in Form von Diagnostik und entsprechender Behandlung. Durch
die ungleiche Verteilung des Expertentums, Fachärzteschaft vs. Patient*in, entsteht ein
Ungleichgewicht in der Beziehung, das im SPZ aufgelöst wird.
Im SPZ treffen Expert*innen in eigenen Angelegenheiten auf Expert*innen für
Lösungsprozesse. Die Expertise ist auf beiden Seiten gleichmäßig verteilt. Das bedeutet:
Expert*innen für eigene Angelegenheiten liefern ihre Expertise und Inhalte für die Expert*innen
für den Lösungsprozess. Gemeinsam werden individuelle, anschlussfähige und
personenzentrierte Lösungen kreiert. Anstatt Defizite und „kranke Anteile“ zu fokussieren,
werden individuelle Möglichkeiten und Ressourcen in den Blick genommen, um Perspektiven
zu eröffnen, Neues auszuprobieren und „einzuüben“, zu begleiten und zu verselbstständigen.
Voller Neugierde für das Gegenüber werden Türen geöffnet, Rückenwind gegeben,
gemeinsamen Erlebnissen ermöglicht, um den Grundstein für Wachstum, Veränderung und
Hoffnung zu legen.
Grundlegend dabei ist die Haltung: also der Blick auf das Gegenüber. Das SPZ als ein Raum
der Begegnung, zeichnet sich durch Empathie und einer bedingungslosen Annahme des
Gegenübers aus, gepaart mit einer symmetrischen, liebevollen und verbindlichen
Beziehungsgestaltung.
Das Herzstück: die Kontakt- und Beratungsstelle
Der Weg ins SPZ führt im Idealfall über die offene Sprechstunde (ohne Anmeldung, mit wenig
Wartezeit) oder manchmal auch spontan „zwischen Tür und Angel“. In einem Erstgespräch
(Clearing) werden Bedürfnisse und Anliegen gehört. Manchmal geht es nur um das Einholen
einer Information, manchmal um eine Weitervermittlung zu einer spezialisierten Stelle und
manchmal hilft einfach nur zuhören. Anderen hilft eine Sequenz von 10 Sitzungen
systemischer oder psychosozialer Beratung oder die Anbindung an die vielfältige
Angebotsstruktur in der Kontaktstelle oder an unseren ambulanten Bereich.
Die Kontaktstelle eröffnen einen psychisch-emotional sicheren Raum, der Ausprobieren und
Lernen, sowie Gemeinschaft unter Gleichgesinnten oder Ausflüge in der Gruppe ermöglicht.
Die Angebote reichen von der Bewegungs- und Sportgruppe, über Kunsttherapie, Kreativ-,
Frauen- und Angehörigengruppe, bis hin zu verschiedenen Ausflügen. Dazu gehören
beispielsweise Bootsfahrten oder Besuche im Zoo und auf Weihnachtsmärkten. Ergänzt
werden die Angebote durch gemeinsames Frühstücken oder Brunchen. Aber auch
Angehörigen- und Selbsthilfegruppen oder Themen wie Prävention und Psychoedukation,
finden ihren Platz.
Neben dem Austausch über Tipps und Erfahrungen zu Bewältigungsstrategien, unterstützen
sich Nutzende beispielsweise durch gegenseitige Begleitungen bei Arztbesuchen. Andere
berichten wiederum wie wichtig Gemeinschaft, Verbundenheit, Akzeptanz, Anerkennung und
Tagesstruktur sind, um mentale Tiefen zu überwinden. Grundsätzlich richtet sich das
facettenreiche Programm an den Bedürfnissen und Interessen der Nutzenden aus, die
wiederum im Nutzenden-Beirat organisiert sind.
Ambulante Begleitung im eigenen Lebensumfeld
Die Bausteine der Kontakt- und Beratungsstelle werden durch den ambulanten Bereich
ergänzt und abgerundet. Hier stehen verschiedene Möglichkeiten der ambulanten Begleitung
und Unterstützung zur Verfügung. Das klassische BeWo (Begleitetes Wohnen) wird durch das
APPV-Modellprojekt (ambulante psychiatrische Pflege und Versorgung) der AOK ergänzt. Die
Niederschwellige Wiedereingliederungshilfe (NSE), in Kooperation mit dem
Sozialpsychiatrischem Dienst der Stadt Köln, rundet das Angebot ab. Ambulante Begleitung
bedeutet: eine strukturierte, regelmäßige, intensive und längerfristige Begleitung und
Unterstützung, im Lebensraum der Nutzenden, mit einer festen Bezugsbetreuung. Die o.g.
Haltung bildet sich auch im ambulanten Setting ab.
Sinn, Zweck und Ziel für alle Bereiche des SPZ können vereinfacht und verkürzt als Hilfe zur
Selbsthilfe beschrieben werden. Das Wort Hilfe ist dabei dahingehend zu verstehen, dass
individuelle, bedürfnis- und personenzentrierte Lösungen, in Zusammenarbeit mit den
Nutzenden erarbeitet werden, um Teilhabe an Gesellschaft zu ermöglichen. Konkret kann das
bedeuten, dass ein größtmögliches Maß an Unabhängigkeit, Lebensfreude und
Selbstständigkeit erreicht wird, um ein Leben nach eigenen Wünschen und Plänen zu
ermöglichen und zu gestalten. Auch wenn möglicherweise Symptome bzw. limitierende
physische oder psychische Faktoren vorhanden sind.
Zahlen, Daten, Fakten
Das SPZ Köln-Porz öffnete 1994 seine Türen und ist für den Stadtbezirk 7, also für Eil, Elsdorf,
Ensen, Finkenberg, Gremberghoven, Grengel, Langel, Libur, Lind, Poll, Porz, Urbach, Wahn,
Wahnheide, Westhoven und Zündorf, zuständig.
Im Stadtteil Köln-Porz leben ca. 115.000 Menschen, von denen sich ca. 62.605 im „statistisch
relevanten Alter“, zwischen 18 und 60 Jahren, befinden. Ein Blick in die Statistiken zeigt, dass
jedes Jahr in Deutschland 27,8% aller Erwachsenen psychisch erkranken. Die Prävalenz auf
Köln-Porz heruntergerechnet bedeutet: jedes Jahr trifft 17.405 Menschen in Köln-Porz eine
psychische Erkrankung. Diese Zahl kumuliert mit den bestehenden psychisch erkranken
Menschen. Hinzu kommen oft Angehörige, die Hilfe und Unterstützung suchen, weil sie mit,
bis dato unbekannten, Situationen konfrontiert werden.
Während der grundsätzliche Bedarf hoch ist, Tendenz steigend, nimmt die Quantität der
psychiatrischen Versorgung eher ab. Termine bei Fachärztinnen und Ärzten für Psychiatrie, im
Bereich der Psychotherapie, Institutsambulanzen oder Psychiatrischen Kliniken, sind
Mangelware und mit sehr langen Wartezeiten verbunden, während auf der anderen Seite, bei
Betroffenen und Angehörigen, der psychische, aber auch manchmal der existenzielle
Leidensdruck hoch ist. Dieser Trend bildet sich in den Zahlen des SPZ-Porz wieder. Das
Personal wurde in den letzten zwei Jahren, auf 17 Mitarbeitende, fast verdreifacht.
2024
Beratungsgespräche: 2032
Anzahl Besuche der Kontaktstelle: 3383 (exkl. Beratungen)
Gruppenangebote: 494
Ambulant betreute Menschen: 117
Psychiatrie bleibt politisch
Psychiatrie war nie unpolitisch – sie war Spiegel gesellschaftlicher Ordnungen. Heute, im
Erstarken rechtspopulistischer und rechtsextremer Strömungen, geraten Reformideen unter
Druck. Psychisch kranke Menschen werden erneut als „gefährlich“, als „Risiko für die
Gesellschaft“ eingestuft. Es gibt erste Versuche aus der Politik, Melderegister zu erstellen. Die
NS-„Euthanasie“ begann nicht in Gaskammern, sondern in Begriffen: „lebensunwert“,
„nutzlos“, „Ballastexistenz“. Eine Demokratie muss wachsam bleiben – Sprache ist nie
harmlos, die Sprache der Ausgrenzung und Stigmatisierung hat gefährliche Tradition – und
beginnt lange vor der Tat. Die „gefährlichen Irren“ von damals sind zu wertvollen Mitgliedern
unserer Gesellschaft geworden und das muss so bleiben. Ein Rückschritt aufgrund politischer
Irrwege wäre fatal. Mit Blick auf die lokalen und globalen Bühnen der Politik und ihren
gesellschaftlichen Erscheinungen stellt sich die altbekannte Frage, ob wir womöglich die
Falschen behandeln.
Ausblick: Haltung zeigen
Gemeindepsychiatrie ist mehr als Versorgung – sie ist Ausdruck eines Menschenbildes. Sie
muss heute mehr denn je Haltung zeigen: Gegen Entsolidarisierung, gegen Abwertung, für
eine Gesellschaft, in der Menschen mit psychiatrischen Diagnosen nicht stigmatisiert, sondern
als Teil menschlicher Vielfalt anerkannt werden. Schließlich kann es jede und jeden von uns,
jederzeit, treffen. Die Wahrscheinlichkeit für eine psychische Erkrankung ist hoch: jedes Jahr
trifft es ca. 28% aller erwachsenen Menschen, also fast jeden Dritten.
Matthias Reuter






























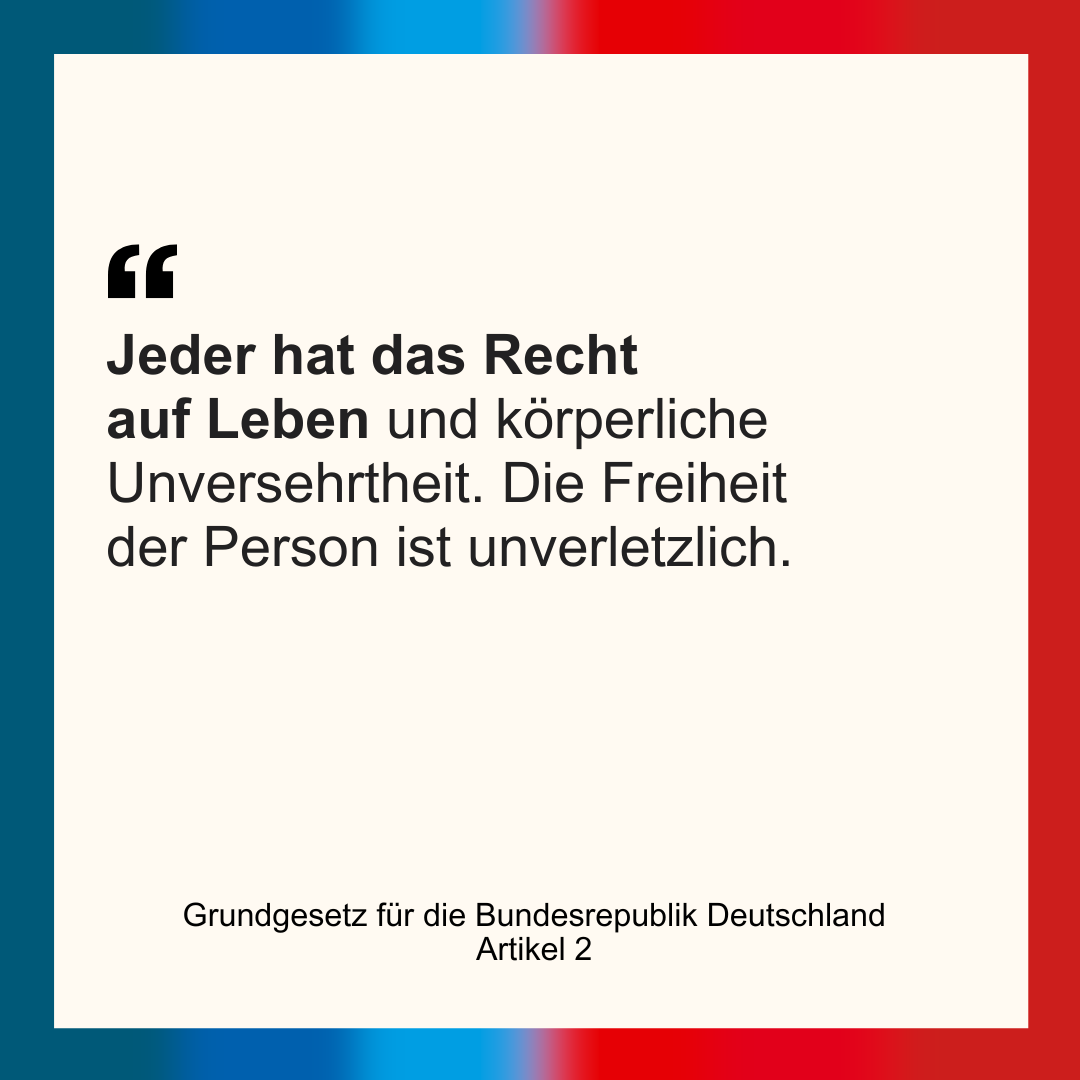 1. Die Menschen in den Mittelpunkt stellen
1. Die Menschen in den Mittelpunkt stellen
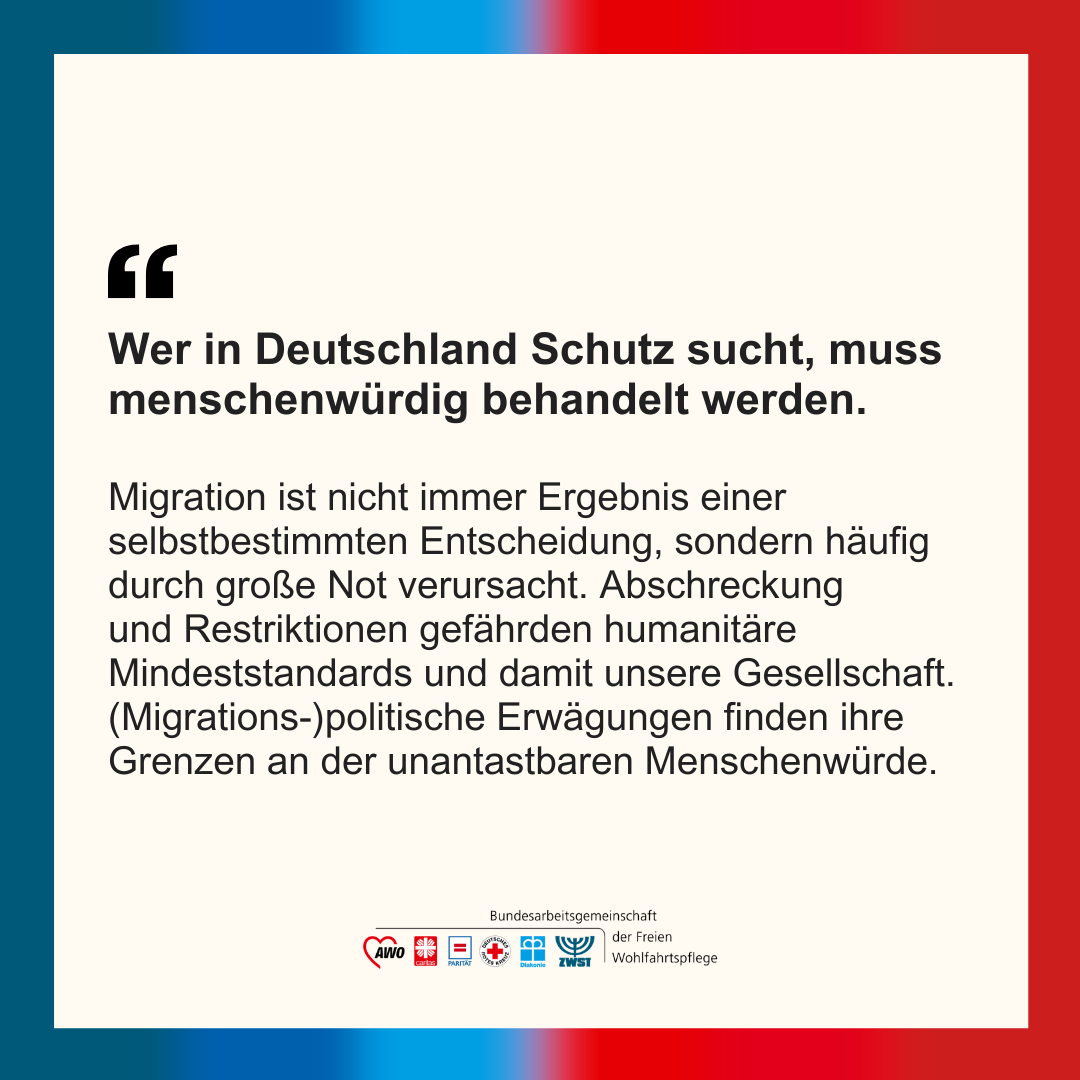
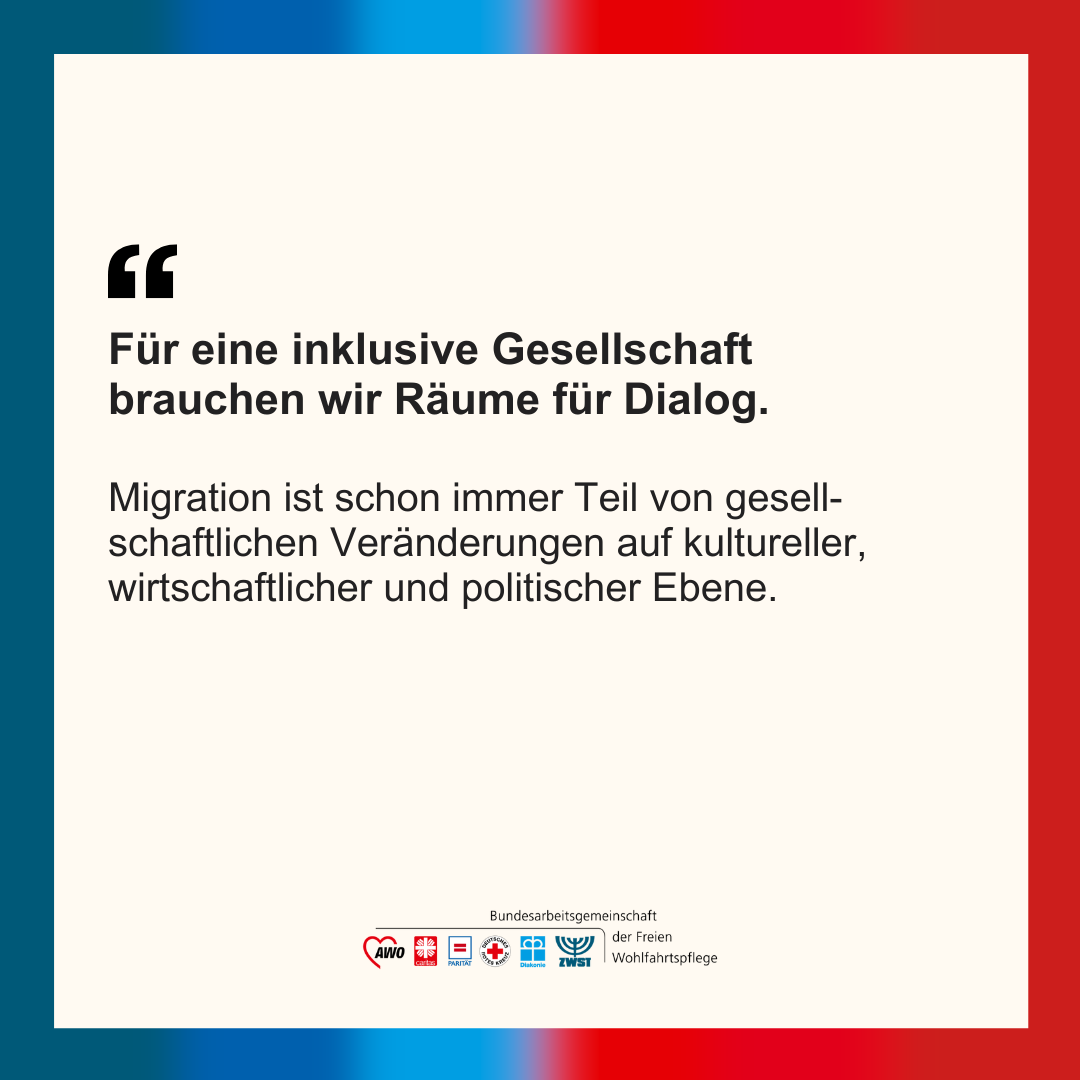 . Visionen aktiver Teilhabe in einer pluralen Gesellschaft stärken
. Visionen aktiver Teilhabe in einer pluralen Gesellschaft stärken