„Das Jugendcafe Bugs – eine Insel für junge Menschen –
Das Jugendcafé Bugs der Caritas Köln ist ein Treffpunkt für junge Menschen zwischen 14 und 24 Jahren in der Kölner Innenstadt. Für alle Besucher*innen haben die pädagogischen Mitarbeiter*innen ein offenes Ohr. Beziehungsarbeit, Hilfe bei der Arbeitsmarktintegration sowie bedarfsorientiere Weitervermittlung an entsprechende Fachdienste sind fester Bestandteil dieses Angebots. Im „Bugs“ finden junge Menschen einen geschützten Ort zum Erwachsenwerden und konkrete Hilfestellungen bei Problemen.

Wir haben mit der Einrichtungsleitung Sarah Hannappel über das Besondere der offenen Jugendarbeit im Cafe Bugs gesprochen.
Was ist das Besondere am Jugendcafé BUGS? Welche besonderen Angebote gibt es im “BUGS”?
Das BUGS Jugendcafé ist ein sicherer und offener Raum im Herzen von Köln für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 24 Jahren. Die Räumlichkeiten sind zwar klein, aber gemütlich und wurden kürzlich renoviert, sodass eine einladende Café-Atmosphäre entstanden ist, die zum Verweilen einlädt. Die zentrale Lage mitten in der Innenstadt ist gut erreichbar und lockt Besucher*innen aus allen Stadtteilen an. Besonders ist auch die Vielfalt der Angebote, die genau auf die Bedürfnisse unserer jungen Besuchenden zugeschnitten sind: Ein Teammitglied, das Gebärdensprache spricht, ermöglicht auch gehörlosen Jugendlichen einen Zugang zu den Angeboten und der Gemeinschaft. Unsere Freizeitangebote umfassen u. a. Billard, Kicker, Gesellschaftsspiele, gemeinsames Musizieren, Gaming und Kochabende. Spezielle Events wie der Mädchentag und der Jungs-Abend geben Jugendlichen Raum für geschlechterdifferenzierte Themen und Aktivitäten. In regelmäßigen Abständen veranstalten wir musikalische Jam-Sessions und kleine Konzerte, bei den die Jugendliche die Möglichkeit erhalten, musikalisch aufzutreten. Besonders wichtig sind für uns Ausflüge und mehrtägige Fahrten, die den Jugendlichen unvergessliche Erlebnisse und die Chance zur Entfaltung bieten.
Wer kommt ins BUGS?
Zu uns kommen Jugendliche und junge Erwachsene aus den verschiedensten Lebenssituationen, häufig mit sehr unterschiedlichen Herausforderungen. Viele unserer Besucher*innen sind psychosoziale belastet, was insbesondere seit der Corona-Pandemie stark zugenommen hat. Ein großer Teil hat Fluchtbiografien, andere kommen aus schwierigen familiären Verhältnissen oder leben mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen. Hinzu kommen oft Erfahrungen von Rassismus und Diskriminierung. Wir sind stolz darauf, ein Ort zu sein, an dem sie all diese Themen in einem vertrauensvollen Rahmen besprechen und Unterstützung finden können.

Warum ist dieses Angebot der offenen Jugendarbeit so wichtig?
Die offene Kinder- und Jugendarbeit im BUGS Jugendcafé bietet Jugendlichen die Möglichkeit, einen Raum zu finden, in dem sie verstanden werden und sich angenommen fühlen. Ein wesentlicher Aspekt ist die Niedrigschwelligkeit unseres Angebots: Alles ist freiwillig und kostenlos, was besonders wichtig ist, damit alle jungen Menschen Zugang haben – unabhängig von ihrer finanziellen oder sozialen Situation. Die Jugendlichen können zu uns kommen und gehen, wann sie möchten, ohne sich an feste Zeiten oder Verpflichtungen halten zu müssen.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Partizipation der Jugendlichen. Sie gestalten das Jugendcafé aktiv mit und entscheiden in hohem Maße mit, welche Angebote stattfinden und wie der Raum genutzt wird – das BUGS Jugendcafé ist ihr Raum. Diese Mitbestimmung stärkt das Gefühl von Eigenverantwortung und Zugehörigkeit und gibt ihnen die Freiheit, das Café nach ihren eigenen Interessen und Bedürfnissen zu formen. Gerade junge Menschen mit komplexen Lebenssituationen profitieren von einem Ort, an dem sie Krisen gemeinsam bewältigen und die Jugend positiv erleben können, ohne sich für ihre Hintergründe rechtfertigen zu müssen. Die steigenden psychosozialen Belastungen zeigen, wie wichtig ein stabiler und sicherer Rückzugsort ist, der auch langfristige Beziehungen und Erlebnisse ermöglicht.
Wie kann die Einrichtung dazu beitragen die Lebenswege der jungen Menschen positiv zu beeinflussen?
Im BUGS Jugendcafé arbeiten wir sehr beziehungsorientiert. Durch stabile, vertrauensvolle Beziehungen, die auf gegenseitigem Respekt beruhen, können die Jugendlichen sich öffnen und in Krisensituationen wertvolle Unterstützung erhalten. Unser Team vermittelt sie bei Bedarf auch an geeignete Hilfestellen und begleitet sie möglichst auf diesem Weg, um sicherzustellen, dass sie an die passende Unterstützung angebunden sind.
Ein großer Mehrwert entsteht zudem durch die sozialen Kontakte, die sich hier entwickeln: Freundschaften entstehen, die den Jugendlichen Halt geben, und auch Konflikte bieten Lernmöglichkeiten, um gemeinsam mit anderen Lösungen zu finden. Die Freizeitangebote, die gemeinsamen Aktivitäten und Gespräche stärken nicht nur ihr Selbstwertgefühl, sondern helfen ihnen auch, ihre sozialen Fähigkeiten auszubauen. Wir unterstützen sie dabei, ihre eigenen Ressourcen zu entdecken, und helfen ihnen, Perspektiven für ihre Zukunft zu entwickeln – sei es in Ausbildung, Job oder in persönlichen Projekten.
Welche Möglichkeiten bieten die Angebot im BUGS, Integration von geflüchteten Jugendlichen zu fördern?
Im BUGS Jugendcafé schaffen wir einen offenen, sicheren Raum, in dem geflüchtete Jugendliche die Möglichkeit haben, sich zu integrieren und soziale

Kontakte zu knüpfen. Viele unserer Besuchenden haben traumatische Erfahrungen in ihren Herkunftsländern und während ihrer Flucht gemacht, was ihre Integration in die deutsche Gesellschaft erschwert.
Um diesen Jugendlichen die Unterstützung zu bieten, die sie benötigen, arbeiten wir eng mit dem Fachdienst Integration und Migration der Caritas zusammen. Regelmäßig begleiten Fachkräfte aus diesem Bereich den Öffnungsbetrieb des Jugendcafés, um Clearing-Beratungen anzubieten. Diese unmittelbare Verfügbarkeit ermöglicht es den Jugendlichen, ohne Hürden Fragen zu klären, Informationen zu erhalten und bei Bedarf weitere Beratungstermine in Anspruch zu nehmen.
Ein zentraler Bestandteil unseres Angebots ist die Möglichkeit, in einem vertrauensvollen Rahmen über persönliche und sensible Themen zu sprechen. Jugendliche haben die Gelegenheit, über ihre Identitätsfindung, Geschlechterrollen und die Herausforderungen, die Diskriminierung mit sich bringt, offen zu diskutieren. Diese Gespräche fördern nicht nur die Reflexion, sondern tragen auch dazu bei, eine respektvolle Diskussionskultur zu etablieren, in der alle Stimmen gehört werden.
Darüber hinaus spielt Sport eine wichtige Rolle in unserem Café. Viele Jugendliche nutzen sportliche Aktivitäten, die wir außerhalb des Jugendcafés anbieten, als Ventil für psychischen Stress und als Gelegenheit, ihre sozialen Fähigkeiten zu stärken. Bei Angeboten wie dem offenen Fußballspiel fördern wir nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch den sozialen Austausch und das Gemeinschaftsgefühl. Hier lernen die Jugendlichen, miteinander zu kommunizieren, Teamarbeit zu schätzen und Konflikte konstruktiv zu lösen.
Insgesamt zielt unser Ansatz darauf ab, geflüchtete Jugendliche in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, als gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft zu wachsen. Durch die Bereitstellung von Ressourcen, Informationen und einem sicheren Raum helfen wir ihnen, ihre Herausforderungen zu bewältigen und Perspektiven für ihre Zukunft zu entwickeln.
Gibt es eine besondere Erfolgsgeschichte? Welches Schicksal/ Geschichte ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
Eine Geschichte, die uns sehr berührt hat, ist die eines jungen Geflüchteten, der bei uns Halt fand, nachdem er allein nach Deutschland gekommen war. Anfangs sehr schüchtern und zurückgezogen, begann er nach und nach, die Angebote aktiv zu nutzen. Über die Zeit hat er sich durch die Beziehungsarbeit bei uns so weit öffnen können, dass er Freundschaften geknüpft und Deutsch gelernt hat. Er schloss eine Ausbildung erfolgreich ab und kommt noch heute als Mentor für andere Jugendliche ins BUGS Jugendcafé zurück. Solche Geschichten zeigen uns, wie viel Kraft im gemeinsamen Engagement steckt.
Die Zukunft des BUGS – wie geht es weiter?

Für die Zukunft wünschen wir uns, dass das BUGS Jugendcafé ein stabiler Ort der Sicherheit und Unterstützung für alle Jugendlichen bleibt, die zu uns kommen. Wir sind entschlossen, weiterhin laut zu sein – sowohl bei drohenden Haushaltskürzungen als auch bei politischen Strömungen, die unsere vielfältigen Werte angreifen. Die Bedeutung der offenen Jugendarbeit ist enorm, und wir setzen uns aktiv dafür ein, dass die Stimmen der Jugendlichen gehört werden.
Sollte es uns gelingen, unser Angebot langfristig zu sichern, träumen wir davon, unsere Aktivitäten weiter auszubauen. Unsere räumlichen Kapazitäten sind begrenzt, da das Jugendcafé lediglich aus einem länglichen Raum besteht. Ein zusätzlicher Raum für Musikprojekte sowie ein Außengelände mit Sportmöglichkeiten wären hervorragende Erweiterungen, die den Jugendlichen mehr Freiräume für kreative und sportliche Aktivitäten bieten.
Ein zentraler Aspekt unserer zukünftigen Angebote wird die Bedeutung von Fahrten und erlebnispädagogischen Aktivitäten sein. Solche Ausflüge fördern nicht nur den Teamgeist und die sozialen Fähigkeiten, sondern bieten den Jugendlichen auch die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln, ihre Perspektiven zu erweitern und sich in einem anderen Umfeld auszuprobieren. Zukünftig möchten wir noch mehr solcher Aktivitäten anbieten, um den jungen Menschen unvergessliche Erlebnisse zu ermöglichen und ihre persönliche Entwicklung zu unterstützen. Diese Erfahrungen sind entscheidend, um Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten aufzubauen und die Selbstwirksamkeit zu fördern.
Der Haushaltsentwurf 2025 der NRW-Landesregierung sieht Kürzungen bei zahlreichen sozialen Diensten und Angeboten in Höhe von 83 Millionen Euro vor. Sollten die Kürzungen umgesetzt werden, wird das für viele Menschen in unserem Land sichtbare und spürbare Folgen haben – vielleicht auch für die Jugendlichen des Cafe BUGS; Schließung von speziellen Angeboten wären dann die Folgen.












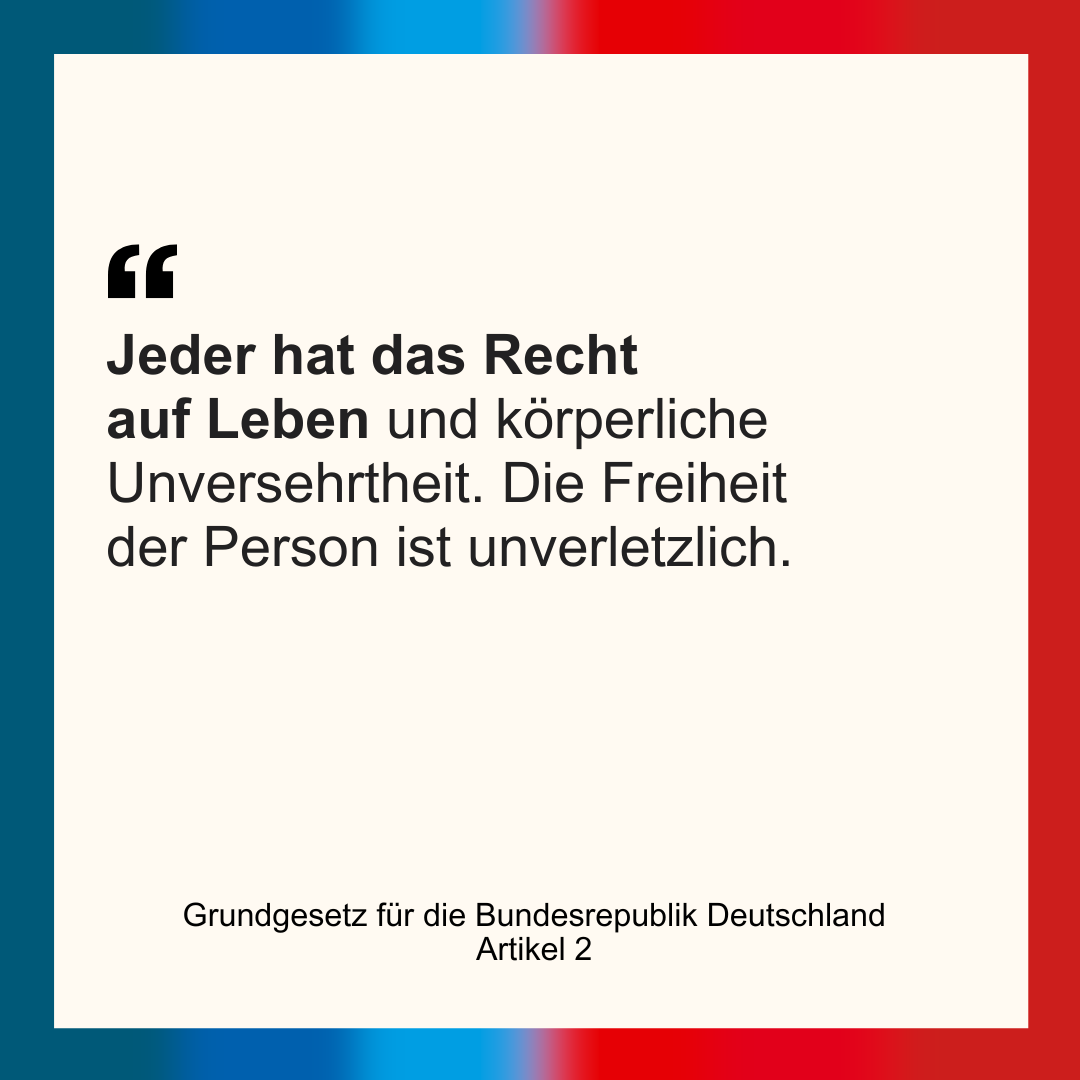 1. Die Menschen in den Mittelpunkt stellen
1. Die Menschen in den Mittelpunkt stellen
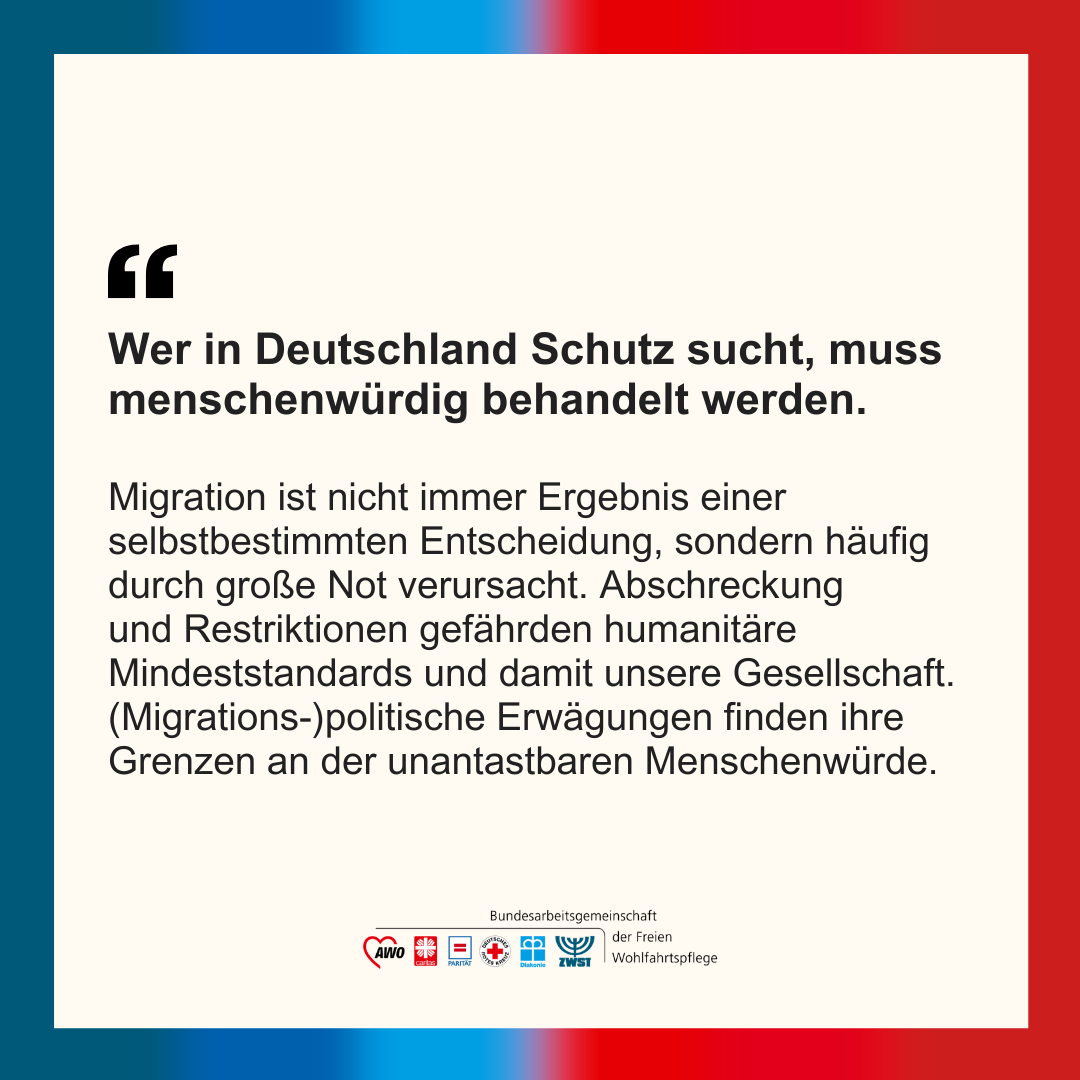
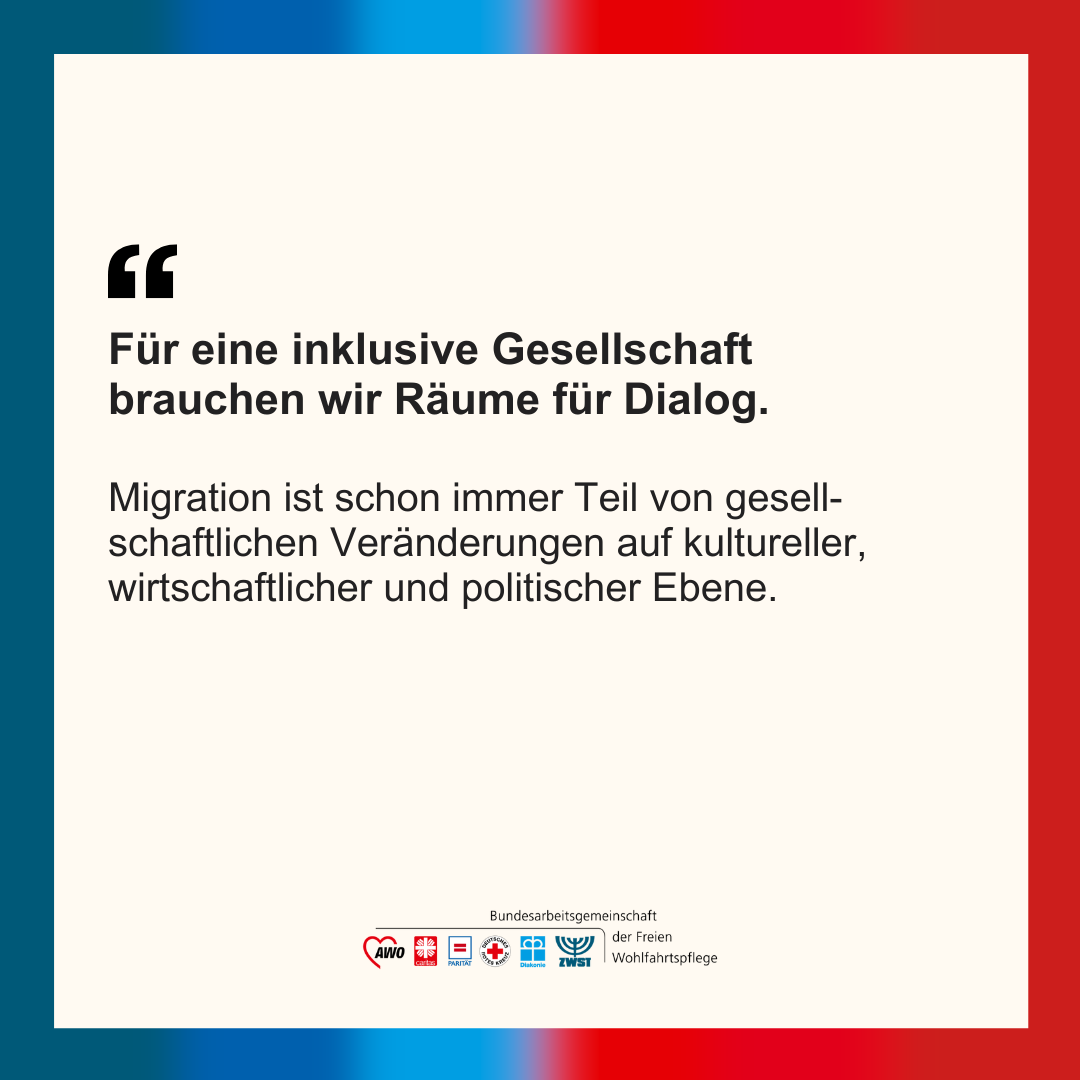 . Visionen aktiver Teilhabe in einer pluralen Gesellschaft stärken
. Visionen aktiver Teilhabe in einer pluralen Gesellschaft stärken


 Tim Westerholt, Leiter des Geschäftsfeldes Integration der Caritas Köln: „Vorsorgehaftmaßnahmen, Abschiebungen und untersagter Familiennachzug für Bürgerkriegsflüchtlinge zerreißen Familien und gefährden die seelische Gesundheit insbesondere von Kindern und Jugendlichen. Dies widerspricht der Menschenwürde, dem Grundgesetz und europäischen Kindeswohlverpflichtungen. Und es führt unweigerlich zu weiteren Traumatisierungen bei den Betroffenen. Wir fordern, bei allen politischen Entscheidungen die Rechte und das Wohl aller Menschen, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, an erste Stelle zu setzen.“
Tim Westerholt, Leiter des Geschäftsfeldes Integration der Caritas Köln: „Vorsorgehaftmaßnahmen, Abschiebungen und untersagter Familiennachzug für Bürgerkriegsflüchtlinge zerreißen Familien und gefährden die seelische Gesundheit insbesondere von Kindern und Jugendlichen. Dies widerspricht der Menschenwürde, dem Grundgesetz und europäischen Kindeswohlverpflichtungen. Und es führt unweigerlich zu weiteren Traumatisierungen bei den Betroffenen. Wir fordern, bei allen politischen Entscheidungen die Rechte und das Wohl aller Menschen, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, an erste Stelle zu setzen.“









 Der Murmeltiertag liegt zwar eigentlich am 2. Februar, in der Migrations- und Flüchtlingsarbeit wird er aber gerne in die Sommerpause gelegt! In routinemäßiger Regelmäßigkeit trudeln die neuen Hiobsbotschaften zu Kürzungsabsichten auf Bundes- und Landesebene bei den Trägern ein.
Der Murmeltiertag liegt zwar eigentlich am 2. Februar, in der Migrations- und Flüchtlingsarbeit wird er aber gerne in die Sommerpause gelegt! In routinemäßiger Regelmäßigkeit trudeln die neuen Hiobsbotschaften zu Kürzungsabsichten auf Bundes- und Landesebene bei den Trägern ein.
 war „Nächstenliebe“ das Thema der interreligiösen Reihe.
war „Nächstenliebe“ das Thema der interreligiösen Reihe. tionsagenturen
tionsagenturen